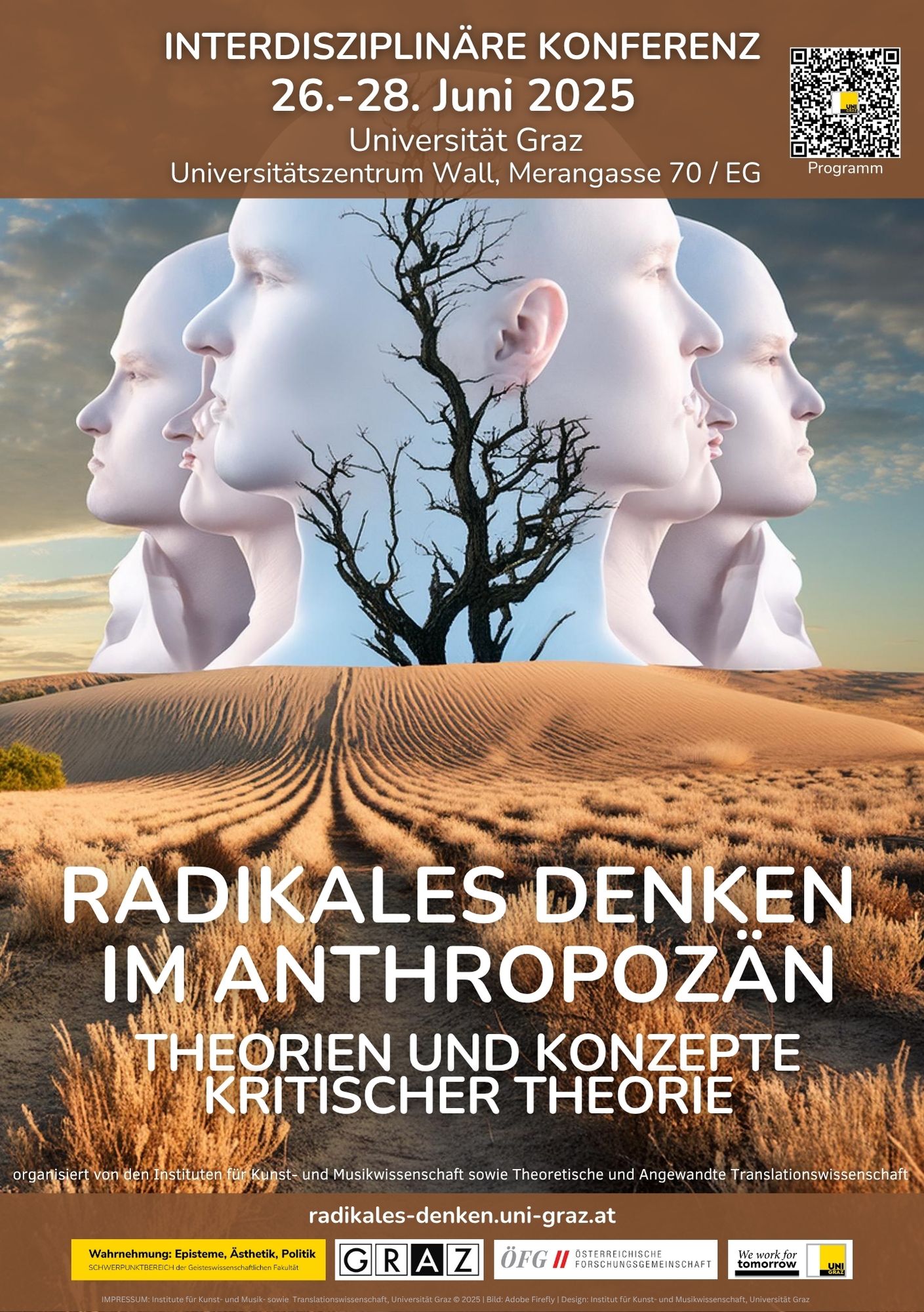Programmablauf
Alle Informationen rund um die Themen des Workshops, die Vortragenden und den zeitlichen Ablauf
Die Konferenz war im Workshop-Format organisiert, 20-minütigen Vorträgen folgte jeweils eine 10-minütige Diskussion.
Folgenden drei miteinander korrespondierenden Themenspektren wurden eingereichten Abstracts zugeordnet.
In diesem Workshop werden diverse Formen und Konzepte von Kritik und Kommunikation einander gegenübergestellt und hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit angesichts aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen wie Multikulturalität, Mehrsprachigkeit, Migration
und moderner Kommunikationstechnologien untersucht. Dabei wird u.a. die kultur- und sprachspezifische Rezeption der ersten Generation der Frankfurter Schule in ihrer Historizität, Aktualität und in Hinblick auf ihr „afterlife“ thematisiert. Besonderes Augenmerk gilt in diesem Zusammenhang der Technologie- und Ideologiekritik. Weitere in diesem Kontext relevante Kategorien umfassen Phänomene wie Inter- und Transkulturalität, Dekonstruktion und Text, Medialisierung und Multimodalität, Globalisierung und Kultur sowie genderspezifische Fragenkomplexe.
Die Frage nach dem (künstlerischen) „Material“ ist eine der mit Theodor. W. Adornos ästhetischer Theorie verbundenen Kernfragen. Sie ist auch in Hinblick auf die aktuelle Rezeption der Kritischen Theorie von zentraler Bedeutung. Mit der Frage nach Stellenwert, Beschaffenheit und Konzeptualisierung des Materiellen werden nicht zuletzt die marxistischen Wurzeln der Kritischen Theorie zur Diskussion gestellt, sondern auch deren konkrete politische und lebenspraktische Relevanz. In diesem Workshop werden Philosophie und sozialwissenschaftliche Kritik sowie (Historischer) Materialismus und (Neo-)Idealismus gegeneinander abgewogen. Von besonderem Interesse ist hier das Verhältnis von neuen Materialismen und Kritischer Theorie. Weitere relevante Themenfelder bilden (Welt)Literatur, Digitalisierung und Mediatisierung, Kunst und (Ideologie)Freiheit sowie (künstlerischer) Aktivismus und Politik.
Das Verhältnis von Wissenschaft und Kritik steht in diesem Workshop zur Diskussion, wobei die Frage nach der Rolle der Geisteswissenschaften für kritisches Denken und zukunftsverändernde Praxis einen zentralen, selbstreflexiven und -kritischen Fokus bildet. Unter anderem wird diskutiert, wie die Wissenschaft Begrifflichkeiten, Theorien und Argumente der Kritischen Theorie reflektieren und damit für ein besseres Leben, für ein radikales „wildes Denken“ fruchtbar machen kann, das unterschiedliche Realitätsbezüge, Kunstwelten, mitunter auch Anarchismen generiert. Dichotomes Denken, Post- und Transhumanismus sowie Anthropologie und Geschichte sind weitere mögliche Themenfelder. Auch das Verhältnis von Kritik und (Un)vernunft sowie Kritik,
Empörung und Widerstand soll zur Diskussion gestellt werden.
Im Rahmen der Internationalen Konferenz "Radikales Denken im Anthropozän" wird Coralie Fargeats provokanter Sci-Fi-Kurzfilm Reality+ (2014) am Freitag, 27. Juni, von 16:00 bis 17:30 Uhr im Cinema Geidorf (Geidorfplatz 1a, 8010 Graz) gezeigt. Der Eintritt ist frei, und im Anschluss an die Vorführung findet eine Podiumsdiskussion statt. Es diskutieren Antonia Hofstätter (University of Warwick), Guilherme Maia De Oliveira Wood, Saptarshi Mallick, Susanne Kogler (alle Universität Graz), Moderation: Stefan Baumgarten (Universität Graz).
Reality+ spielt in einem glatten, hypermodernen Paris der nahen Zukunft und erforscht eine Welt, in der Menschen neuronale Implantate einsetzen können, die es ihnen - und anderen - ermöglichen, sich als ihr idealisiertes Selbst zu sehen. Vincent, die Hauptfigur des Films, ist von ganzem Herzen von dieser Technologie begeistert, vor allem nachdem er seine Kollegin Stella kennengelernt hat. Aber das tägliche 12-Stunden-Limit des Systems beginnt die Grenze zwischen Wunsch und Wahn zu verwischen und zwingt beide Charaktere, sich mit den emotionalen Auswirkungen der erweiterten Identität auseinanderzusetzen.
Mit scharfen Bildern und bissigen sozialen Kommentaren setzt sich der Film mit Fragen des Körperbildes, der Selbstwahrnehmung und dem wachsenden Druck, unsere Erscheinungen zu kuratieren, auseinander - sowohl online als auch offline. Im Zeitalter des digitalen Enhancements und der biotechnologischen Träume wirft Reality+ eine aktuelle Frage auf: Was passiert, wenn das ideale Selbst das reale Selbst ersetzt?
Die Diskussion im Anschluss an die Filmvorführung wird sich mit den weiteren Auswirkungen dieser Themen befassen, insbesondere im Kontext des Anthropozäns, in dem Technologie, Identität und ökologische Krise auf immer radikalere Weise aufeinandertreffen. Alle sind herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen.
Konferenzort
Das Symposium 2025 findet im Raum MR 33.0.010 im Universitätszentrum Wall, Merangasse 70, 8010 Graz statt.